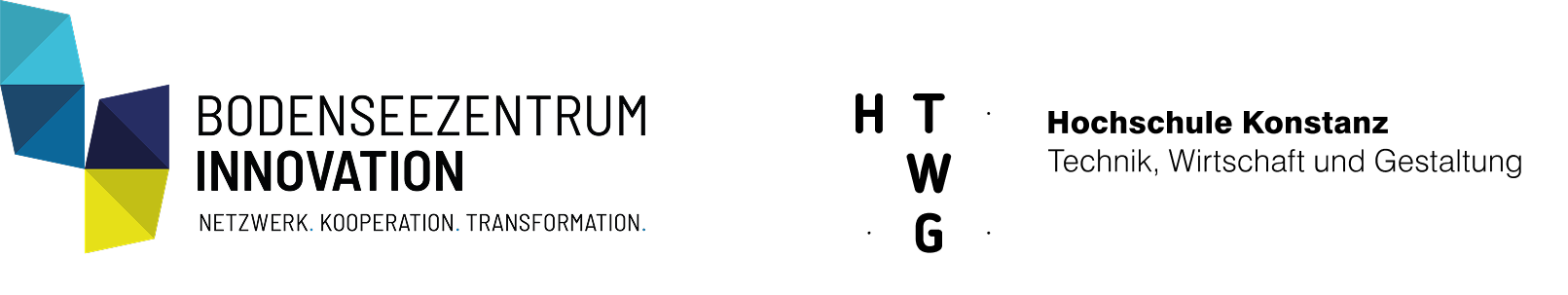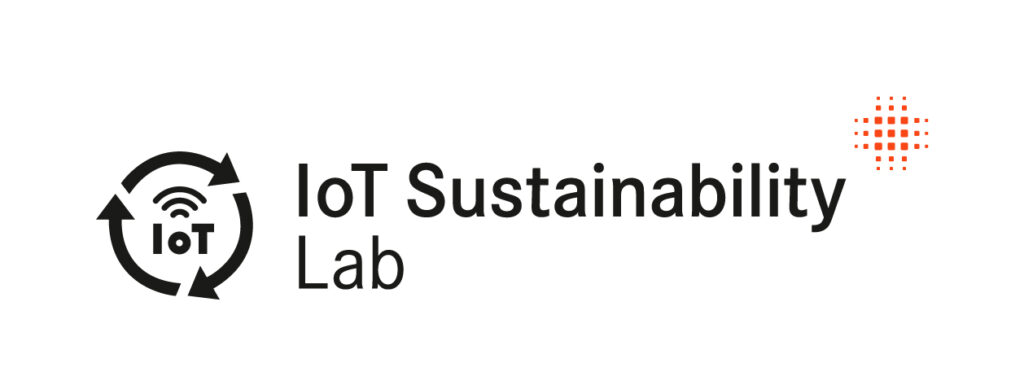
Grundidee
Am 25. September 2024 waren zahlreiche Lab-Mitglieder der verschiedenen Konsortialpartner des Labs an der FH Vorarlberg zu Gast um ihre Zusammenarbeit zu koordinieren, um sich fachlich zum Forschungsschwerpunkt des Labs „Nachhaltigkeitseffekte des Internet of Things am Anwendungsbeispiel des Gebäudesektors“ auszutauschen und um die gemeinsame Entwicklung nützlicher Tools für Zielgruppen aus Wirtschaft und Verwaltung voranzubringen.


Positionsbestimmung
Eingangs ordneten die fachliche Lab-Leiterin Prof. Dr. Doris Bohnet und der Lab-Manager Dr. Damian Bäumlisberger von der HTWG Hochschule Konstanz die aktuellen Fortschritte des Labs aus Fach- und Managementsicht ein und Prof. Dr. Dieter Uckelmann von der Hochschule für Technik Stuttgart eröffnete dem Lab eine wertvolle Außenperspektive auf seine Position in der Forschungslandschaft, indem er seine vielfältige Erfahrung bei der Durchführung von Forschungsprojekten zu IoT-Systemen in Gebäuden mit dem Lab teilte.
Gemeinsame Forschungsarbeit
Im Anschluss stand der fachliche Austausch zu konkreten Forschungsvorhaben des Labs im Fokus. Mitglieder aus zentralen Arbeitsgruppen des Labs präsentierten den aktuellen Stand ihrer Arbeit, erhielten aus den anderen Arbeitsgruppen wichtiges Feedback und diskutierten gemeinsam Herausforderungen und Lösungsansätze für die weitere (Team-)Arbeit.

Corinna Baumgartner von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Winterthur) widmete sich in ihrem Vortrag der Frage wie sich mit digitalen Tools die Nachhaltigkeitsbilanz von Gebäuden ermitteln lässt. Sie diskutierte mit den Teilnehmenden den aktuellen Stand bei der wissenschaftsbasierten Konzipierung und Entwicklung eines Software-Tools für die Nachhaltigkeitsbilanzierung von Gebäuden. Die Entwicklung erfolgt auf Basis eines allgemeingültigen Modells, das anhand von Anwendungsfällen getestet und optimiert wird. Die Software-Architektur des Tools wurde entwickelt und bzgl. eines smarten Heizsystems überprüft. Auf Basis von Datensätzen eines Praxispartners des Labs soll nun systematisch die Anwendbarkeit der Software in verschiedenen Gebäudetypen sichergestellt werden. Zudem steht im Ecolar-Gebäude der HTWG Hochschule Konstanz unter Einsatz diverser IoT-Geräte weiterer Praxispartner die Durchführung eines größeren Anwendungsfalls bevor.
Prof. René Pawlitzek von der Ostschweizer Fachhochschule (Buchs) konzentrierte sich in seinem Vortrag auf die Frage mit welchen IoT-Systemen (informations-)technisch vernetzte Gebäudeversorgungseinheiten nach Nachhaltigkeitszielen gesteuert werden können. Er ging mit den Anwesenden zur Nachhaltigkeit und Interoperabilität von Hard- und Softwarekomponenten nachhaltiger IoT-Systeme in den Austausch. Technische Geräte und Softwareprotokolle zur Datenübertragung in und zwischen I(o)T-Systemen sollten möglichst energieeffizient und miteinander kompatibel sein. Ziel ist die Entwicklung eines allgemeingültigen und modular konzipierten Baukastens für die Planung nachhaltiger IoT-Systeme in Gebäuden.
Simon Weisskopf von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften nahm in seinem Vortrag die Leitfrage in den Blick, welche Geschäftsmodelle und Services einen, für alle Stakeholder vorteilhaften, Einsatz nachhaltiger IoT-Systeme in Gebäuden versprechen. Betrieb und Wartung entsprechender IoT-Systeme erfordern die Bereitstellung von Services, die – bspw. hinsichtlich organisationsübergreifend genutzter Cloud-Infrastruktur für das Daten-Handling oder bezüglich einer effizienten Organisation von Wartungsarbeiten – besondere Anreizstrukturen aufweisen. Auf Basis von Fallstudien mit Praxispartnern werden breit anwendbare Geschäftsmodelle und Konzepte für IoT-Services entwickelt, die auf Basis einer Harmonisierung von Stakeholder-Interessen die Funktionalität von IoT-Systemen sichern.
Nico Meier von der Zeppelin Universität adressierte in seinem Vortrag die Frage wie groß das Potenzial für den weitreichenden Einsatz nachhaltiger IoT-Systeme ist. Er rekapitulierte das Design einer Delphi-Studie zur systematischen Evaluierung des entsprechenden Anwendungspotenzials auf Basis qualitativer und quantitativer Befragungsmethoden und diskutierte mit den anwesenden Lab-Mitgliedern wie die Ergebnisse bisheriger qualitativer Fokusgruppeninterviews in die Lab-Forschung einfließen könnten und welche Aspekte im Zuge weiterer qualitativer und quantitativer Befragungen für die Forschenden aus dem Lab von besonderem Interesse sind. Die Delphi-Studie ist auch fürs Marketing des Labs wertvoll, da sie Aufschluss über Bedürfnisse potenzieller Anwender:innen nachhaltiger IoT-Systeme geben wird.
Anwendungsorientierte Workshops
Auf den halbjährlichen Konsortialpartnertreffen des Labs werden in der Regel anwendungsorientierte Workshops durchgeführt. An der FH Vorarlberg führte Corinna Baumgartner von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften zur Vorbereitung der systematischen empirischen Testung einen Workshop zur Anwendung des Software-Tools zur Nachhaltigkeitsbewertung von IoT-Systemen in verschiedenen Gebäudetypen durch, bei dem es um das gemeinsame Erstellen von Anforderungsprofilen für Büro- und Industriegebäuden ging. Dr. Michael Hellwig von der FH Vorarlberg und Dr. Eugen Rigger von der Zumtobel Lighting GmbH betreuten einen Workshop zu einer anwendungsorientierten Fallstudie in Kooperation mit Zumtobel, die sich auf die energie- und nutzeroptimierte, IoT-basierte Steuerung von Beleuchtungsanlagen in Produktionshallen aus dem Produktportfolio von Zumtobel bezieht.


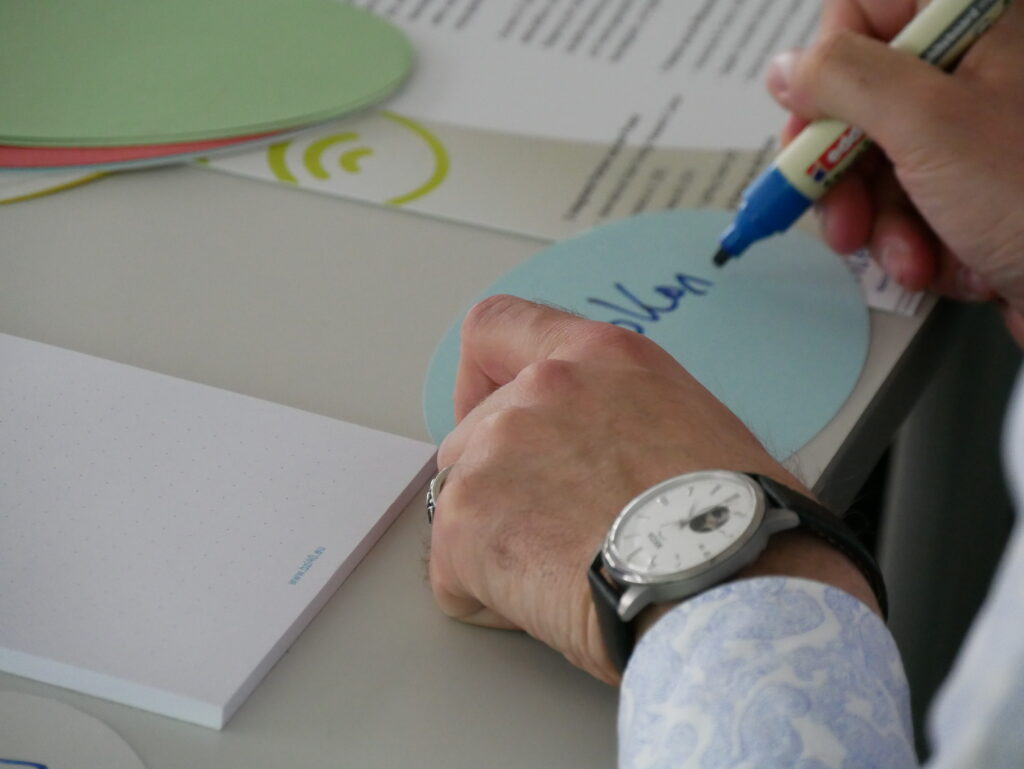
Abschluss und Vernetzung
Die fachliche Lab-Leiterin Prof. Dr. Doris Bohnet und der Lab-Manager Dr. Damian Bäumlisberger von der HTWG Hochschule Konstanz rundeten die Veranstaltung durch ein inhaltliches und organisatorisches Fazit ab. Das Konsortialpartnertreffen hat die Lab-Forschung und die Entwicklung von Lab-Technologien wieder ein ordentliches Stück weitergebracht. Zudem hatten die Anwesenden in Vortragspausen und bei einem Apéro wieder Gelegenheit erhalten sich informell über ihre gemeinsame Forschungsarbeit auszutauschen.